Ein paar Sätze vorweg:
Dieser Reisebericht erhebt nicht den Anspruch, vollständig, genau oder gar objektiv zu sein. Nein, er spiegelt lediglich wieder, wie sich der Ablauf für mich persönlich dargestellt hat. Andere mögen Dinge, die ich bemängele, unwichtig finden, andere ärgern sich vielleicht über Vorfälle, über die ich nur lachen kann. Und was die ganzen angesprochenen Namen, Zeiten, Zahlen und Details jeder Art angeht, sind sie nur ein Spiegelbild dessen, was sich mein Kopf behalten hat. Für exakte Daten bemühe man bitte ein Lexikon, am besten „Wikipedia“ im Internet.
Geschafft. Und zwar völlig. Als mir morgens um 5:15 Uhr die Augen zufallen sollen, klappt es nicht so recht. Ich kann zu allem Überfluss noch nicht einmal einschlafen. Und das, obwohl in weniger als vier Stunden der Wecker klingelt. Schuld an der Misere ist ein großer Organisationsfehler meines Reiseanbieters „Trendtours“.
Ich war ja mit denen schon mal in Slowenien, da hat alles ja mehr oder weniger gut geklappt. Aber was man uns hier angetan hat, habe ich noch nicht erlebt.
Aber der Reihe nach. Trendtours bot vor etwa neun Monaten eine Reise nach Usbekistan an. Der geneigte Leser wird sich verwundert fragen, was um alles in der Welt man da will. Nun, wenn man in seinem Leben schon so oft in den üblichen Urlaubsländern war, muss man auch mal was Neues wagen. Dazu gehörte schon China, Slowenien und Südvietnam – die Reiseberichte finden sich ja alle weiter unten in diesem Blog. Diesmal also Usbekistan – oder Uzbekistan, wie die Einheimischen ihr Land nennen. Für knapp 1900 Euro bot man eine Rundreise durch die „alte Seidenstraße“, wie sich das Land auch gerne verkauft. Die Hotels wie immer vom Feinsten, Transport per Bus, Bahn oder Schiff und Hin- und Rückflug mit Aeroflot. Ich hatte erwartet, mit einer uralten Illjuschin Turbopropmaschine einen ihrer letzten Gnadenflüge mitzumachen, aber weit gefehlt. Die flotte Aeroflot gehört inzwischen zum Sky-Verbund und fliegt daher mit nahezu nagelneuen Airbus-Maschinen.

Um 14.15 Uhr ging es in Frankfurt fast pünktlich los. Bis auf ein paar Luftlöcher (ich weiß, sowas gibt es eigentlich gar nicht), die lautes Geschrei an Bord verursachten, war der Flug zum Zwischenlandepunkt Moskau auch wirklich in Ordnung. Das Essen war essbar, die russischen Stewardessen ausgesprochen ansehnlich, und meine Sitznachbarn waren auch sehr nett. Alkohol gab es übrigens keinen an Bord. Nicht einmal einen Begrüßungswodka mit dem Captain durfte man sich wünschen. Spaß beiseite: Die russische Luftfahrt ist inzwischen absolut auf Weltniveau.
In Moskau durften wir den Flughafen natürlich nicht verlassen, sondern mussten im Transitbereich auf unseren Anschlussflug warten. Wenn ich „wir“ sage, meine ich die anderen Gäste der Reise, die alle ziemlich eng beisammen saßen und sich so schon im Flieger näherkommen konnten. 39 Reiseteilnehmer waren wir. Alle schon alt bis sehr alt. Außer einem Ausreißer – einem jungen Mann um die 40 in T-Shirt und kurzen Hosen. Genug Ablenkung auf dem Moskauer Flughafen gab es, denn er ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Mega-Duty-Free-Shopping-Mall. Hier findet man wirklich jeden noch so ausgefallenen Luxusartikel. Wahrscheinlich zu Preisen, die sich der gemeine Russe nicht leisten kann. Deswegen waren auch viele russische Urlauber an Bord, die sich bei diversen Frankfurter Händlern mit dem Nötigsten eingedeckt hatten. Aus Zollgründen trugen sie ihre ganzen Schätze in überdimensionalen Tüten mit sich rum.
Natürlich gab es kostenloses WLAN auf dem Flughafen, sodass ich in den zwei Stunden Wartezeit meine inzwischen aufgelaufenen Mails beantworten, den einen oder anderen Chat auf WhatsApp und Facebook führen und auch ein paar inzwischen fertiggestellten Sprechaufträge an die Kunden weiterleiten konnte.
Dann ging es endlich weiter nach Usbekistan. Hatten wir bisher mit dem Airbus A320 Vorlieb genommen, durften wir jetzt mit dem ungleich größeren A321 fliegen. Auch hier wieder: Neue Maschine, brauchbares Essen, nettes Personal, KEIN Alkohol.
Der Zeitunterschied zu Deutschland betrug in Moskau eine Stunde, in Usbekistan waren es dann schon drei Stunden.
Um halb drei Ortszeit, also eine halbe Stunde vor Mitternacht nach deutscher Zeit, landeten wir auf dem menschenleeren, recht überschaubaren Flughafen in Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan, wie ja jeder weiß. Wir waren sogar fast 30 Minuten schneller geflogen als es der Flugplan vorsah. Das hatte viele Vorteile, denn nachdem wir unsere Koffer in affenartiger Geschwindigkeit erhalten hatten, standen wir als Einzige vor ca. 20 Ausweiskontrollstellen. Das heißt, wir waren im Nu durch und standen dann plötzlich vor dem Flughafengebäude im Freien. Weit und breit kein Vertreter von „Trendtours“, weit und breit nur Taxifahrer, die in uns leichte Beute witterten.
Ich war einer der Ersten und entdeckte in etwa 200 Metern Entfernung ein paar Reisebusse. In der (richtigen) Annahme, dass hier unsere Reiseleitung sein müsste, liefen wir zu dem ersten Bus, der tatsächlich ein Schild mit „Trendtours“ in der Windschutzscheibe hatte. Die Dame, die uns dann völlig verschlafen entgegen kam, fragte, ob wir zu der Gruppe „Blablabla“ gehören würden (wobei ich mir den Namen natürlich nicht merken konnte). Erst als wir sie aufklärten, dass sie ja wohl die Reiseleiterin von „Trendtours“ sei, bemerkte sie ihren Irrtum und war sichtlich irritiert, dass wir alle schon vor ihr standen. Leider wusste sie nicht, wie viele Personen unsere Gruppe umfasste. Also dackelte sie wieder zurück in den Flughafen – mit „Trendtours“-Schild, um weitere Passagiere abzufangen. Es kamen aber keine mehr, denn wir waren ja alle längst im Bus. Nach ca. 20 Minuten kam sie dann endlich wieder, um zuzugeben, dass da keiner mehr war.
Kaum dass wir losfuhren, der nächste Schock. Unsere Reiseleiterin, eine resolute Frau um die fünfzig, sagte, wir wüssten ja, dass wir in zwei verschiedenen Hotels wohnen würden. Wussten wir natürlich nicht. Wir wussten ja nicht einmal den Namen von EINEM Hotel. Also schlug sie vor, dass wir erst einmal zum ersten Hotel fahren würden, dort alle aussteigen sollten, um herauszufinden, wer denn in diesem Hotel wohnen würde, und dann mit dem Rest ins zweite Hotel weiterzuziehen. Irgendwann wurde sie dann anscheinend doch etwas wacher, denn sie bot an, die Liste der Hotelgäste aus der Rezeption zu holen, um dann vorzulesen, wer alles im Hotel RAMADA wohnen würde. Der Rest müsste dann ja automatisch ins zweite Hotel, das „City-Plaza“ gehören.
Nach ca. 5 Minuten Fahrt ging ein widerlicher Pfeifton durch den angeblich ganz neuen Bus, der gerade erst aus China angeliefert worden sei (was nicht stimmen konnte, denn es fanden sich eine Menge Gebrauchsspuren im Inneren des Busses). Der Fahrer hielt an, stieg aus, kam wieder rein, öffnete ein Fach, entnahm einen Werkzeugkasten und begann, draußen im Freien eine Blinkerbirne zu wechseln. Nachts um halb vier. Als er fertig war, hörte das Pfeifen dann zum Glück auf.
Weitere 20 Minuten später kamen wir im RAMADA an. Unsere Reiseleiterin ging rein, holte die Gästeliste und las laut vor, wer da alles zu wohnen hatte. Datenschutz ade. Ich war jedenfalls nicht dabei. Das hatte ich mir schon gedacht. Übrig blieben genau fünf Einzelreisende, zwei Frauen und drei Männer. Wir mussten also dafür, dass es im ersten Hotel anscheinend keine Einzelzimmer gab, in ein anderes Hotel gekarrt werden.
Um viertel nach vier waren wir endlich da. Unsere Reiseleiterin sammelte unsere Pässe ein und ging zur Rezeption. Dort war man etwas verwundert ob des späten Besuchs. Zimmer waren nämlich keine reserviert. Und frei waren natürlich auch keine. Nicht einmal Doppelzimmer. „Frühestens in einer halben Stunde“ wäre das erste Zimmer dann beziehbar, die anderen jeweils eine halbe Stunde später.
Das muss man sich mal vorstellen. Da reist man zwölf Stunden durch halb Europa bis nach Zentralasien und erfährt dann, dass irgendjemand, dessen Kopf hoffentlich rollen wird, vergessen hat, uns zu buchen. Wir Männer haben natürlich den beiden Damen den Vortritt gelassen. Und die beiden jüngeren Männer haben mich dann auch vorgelassen, als mein Zimmer um 5:15 Uhr endlich bezugsfertig war. Der Jüngste ist gegen sechs ins Bett gefallen.
Das Zimmer ist OK, aber nicht berauschend. Das Bett ist extrem weich, das Kopfkissen hart wie eine Zervelatwurst. Es gibt keinen Tresor. Zum Duschen muss man in eine hochwandige Badewanne steigen.
Der zweite Tag
Und um neun klingelt der Wecker. Frühstück geht nur bis zehn. Ab elf beginnt das Tourprogramm, zunächst mit einer Stadtrundfahrt. Ich bin völlig zermatscht. Selbst nach einer Dusche bin ich nicht wirklich vorhanden. Das Frühstück schlinge ich wie in Trance in mich rein. Ich würde gerne noch ein wenig schlafen, aber es gelingt mir nicht. Immerhin gibt es kostenloses WLAN im Hotel, das sogar recht flott ist. Bis zur Abholung beantworte ich also mal wieder den täglichen Krimskrams aus dem Internet.
Draußen scheint die Sonne. 28 Grad sind angesagt. So wie an ca. 300 Tagen im Jahr.

Die „große Stadtrundfahrt“ entpuppt sich als ziemliche Enttäuschung. Wir besichtigen gerade mal zwei Sehenswürdigkeiten: Eine Moschee und ein jüdisches Museum. Unsere Reiseleiterin ist jetzt endlich in ihrem Element. Sie erzählt uns die gar nicht so schöne Geschichte des Landes emotionslos, schnell und ohne auf Fragen einzugehen. Als das Land noch zu Russland gehörte, gab es quasi keine Religion. Gerade mal fünf Moscheen soll es gegeben haben. Nach der Aufteilung der Länder in selbstständige Staaten 1991 gab es noch die GUS, bis Usbekistan dann ca. 1997 dann tatsächlich ein eigener Staat war. Und damit kamen auch die Moscheen wieder. Bis zu 50.000 Moscheen soll es gegeben haben, bevor man durch entsprechende Regulierungen die Anzahl auf heute ca. 5000 (davon alleine 500 hier in Taschkent) reduzierte. Wir traben durch die verschiedenen Teile der Moschee, lassen uns erklären, was da alles so gemacht wird (heute zum Beispiel das Freitagsgebet) und schauen uns in einem kleinen Basar auf dem Gelände recht hübsche Handarbeiten an. Punkt eins tönt aus dem Lautsprecher des großen Turms der Moschee der Vorsinger – und hunderte Muslime stimmen ein und erledigen ihre religiösen Verpflichtungen. Mein Problem mit Religionen aller Art ist dem Leser dieser Zeilen sicher bekannt, sofern er auch ein paar andere Reiseberichte von mir gelesen hat. Dies kann nicht der richtige Weg zu einem friedlichen Miteinander der Menschheit sein. Erlasst vernünftige Gesetze und lebt danach! Die zehn Gebote waren schon ein ganz guter Anfang, aber unser Grundgesetz regelt das alles noch bedeutend filigraner und vernünftiger.
Die Parkplätze rund um die Moschee sind vollgestellt von hunderten, wenn nicht gar tausenden kleinen weißen Autos der Marke Chevrolet. Ich weiß nicht, wer die Marke hierher verkauft hat, aber derjenige hat einen sauguten Job gemacht. Rund 90% aller Autos tragen den Markennamen Chevrolet, der allerdings inzwischen dem Daewoo-Konzern angehört. Und weil alle durcheinander parken, haben sich die Autobesitzer eine feine Sache ausgedacht: Auf fast jeder Windschutzscheibe befindet sich innen ein kleines Gerät, das man von außen durch Anklopfen „wecken“ kann. Dadurch wird der Besitzer des Wagens per Funk verständigt, dass seine Gurke irgendwie im Weg steht und er gefälligst sofort zu seinem Gefährt kommen soll.

Ich hab´s nicht getestet, denn wir müssen ja weiter.
Ein jüdisches Museum steht auf dem Programm. Schon wieder Religion. Wir sehen alte Teppiche, Keramiken, Wandgemälde und Holzschnitzereien. Belege vergangener Kulturen. Sicherlich sehr schön, gut erhalten und beachtenswert. Das schaue ich mir dann aber auch gerne mal auf ARTE an, dazu muss ich nicht um die halbe Welt reisen. OK, ich bin vielleicht ein Kulturbanause. Mich interessiert die aktuelle Wirklichkeit mehr als die Vergangenheit. Ich will sehen, wie die Menschen hier leben, wie sie wohnen, was sie verdienen. Von unserer Reiseleiterin höre ich nur, dass etwa 30% der Usbeken arbeitslos sind. Von den 32 Millionen Einwohnern (3 davon wohnen in Taschkent) sind allerdings 8 Millionen in Russland und anderen Ländern beschäftigt. Das bedeutet, dass rund 9 Millionen Usbeken arbeitslos sind.
Wir werden nach dem Besuch des jüdischen Museums jedenfalls erst mal wieder für eine Weile im Hotel geparkt, wo sich übrigens inzwischen noch niemand um das Zimmer gekümmert hat. Ein Teil der Truppe hat noch einen „fakultativen Ausflug“ in eine Keramikfabrik gebucht, was vermutlich eine Art Kaffeefahrt ist. Das brauche ich nicht. Ich brauche Schlaf! Und wenn es nur ein Stündlein ist…
Sechzig Minuten später stehe ich wieder vor dem Hotel. Abholung zum Abendessen. Abendessen? Abendessen um 17.00 Uhr? Ja, das ist der Plan. Immerhin hatten wir kein Mittagessen, sodass jeder Happen sehnlichst gewünscht wird. Um wenn ich die Zeitverschiebung einrechne, sind wir ja eigentlich innerlich immer noch bei 14.00 Uhr good old German time.
Wir fahren in ein riesiges Sportzentrum, in dem junge Athleten in allen möglichen Disziplinen trainieren. Sie stehen rum, haben irgendwelche wichtigen Schilder um den Hals hängen und warten auf irgendwas. Worauf sie warten, erschließt sich uns leider nicht.
Auf dem Gelände gibt es jedenfalls ein sehr, sehr, seeehr großes Speiselokal, in dem man uns bereits sehnsüchtig erwartet. Vier Tische á 10 Personen sind bereits eingedeckt. Der Vorspeisensalat steht auch schon da, hoffentlich noch nicht zu lange. Die Getränke gehen – bis auf das warme Wasser – zu unseren Lasten. Ich bin so blöd und bestelle einen Weißwein. Mhm. Wie soll ich den beschreiben? Schon der Essig-Geruch erzeugt Würgereflexe. Egal, ich bin Gast und trinke, was mir vorgesetzt wird.

Das Essen ist recht abwechslungsreich. Es gibt Suppe, Teigtaschen mit Hackfleischfüllung, Hammel mit Kartoffeln und Salat und zwei Sorten Melone. Um uns das Essen angenehmer zu gestalten, tritt vor der Hauptspeise unvermittelt eine Tänzerin in einem geschichtsträchtigen Kostüm auf. Sie tanzt sehr hübsch zur überlauten Musik und lächelt sich dabei einen Wolf. Na gut, genehmigt. Zum Nachtisch beginnt dann noch eine Liveband, sich im Zweiminutenabstand zu verdoppeln. Also erst eine Art Gitarre, dann eine zweite, dann plötzlich noch ein Schlagzeuger und ein Stehbass. Bevor nun als Nächstes acht Geiger und gar noch eine Bläsergruppe jede Unterhaltung unmöglich gemacht hätte, verlassen wir den Laden.

Unsere Reiseleiterin hat es eilig, denn ein Teil unserer Truppe (immerhin 14 Leute!) haben noch einen Besuch im Staatstheater gebucht: ROMEO UND JULIA als Ballett. Die Musik von Prokofiev liebe ich zwar sehr, aber Ballett ist nicht so mein Ding. Und das liegt nicht daran, dass ich in meiner Jugend das ARD-Fernsehballett mit meinen Eltern ertragen musste…
Blöderweise kann man bei „Trendtours“ auch nicht spontan entscheiden, diese fakultativen Ausflüge noch nachträglich zu buchen. Geht nicht, ist nicht vorgesehen, Umsatz verschenkt, dumm gelaufen.
Das waren also die Highlights aus Taschkent, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass so eine Dreimillionenstadt nicht doch noch mehr für Touristen zu bieten hat als Moscheen und jüdische Museen. Aber wir werden ja am vorletzten Tag nochmal hierher zurück kommen. Vielleicht sehen wir dann mehr. Was wir so aus dem Bus heraus gesehen haben, war jedenfalls sehr schön. Wunderbare, breite Allen mit riesigen Grünstreifen dazwischen. Bäume ohne Ende und dadurch eine vergleichsweise saubere Luft, obwohl noch der eine oder andere LADA und viele Dieselautos die Luft verpesten. Alle Bäume (im ganzen Land!) sind übrigens etwa 70cm hoch am Stamm mit weißer Farbe bemalt. Die Farbe enthält ein Insektenschutzmittel und soll Ameisen abhalten. Warum man diese Farbe auch auf Stein- oder Metallmasten aufträgt, bleibt mir allerdings ein Geheimnis. Die Nationen sind hier bunt gemischt, ohne sich gegenseitig zu bekämpfen und sehr freundlich zu uns Touristen. 60% der Einwohner sind unter 25 Jahre alt. Alte Menschen sieht man nur bei den Touristen. Wichtig: Die Sauberkeit. Usbekistan ist extrem sauber. Die Straßen werden ständig von älteren Frauen gekehrt, die vielen Grünanlagen werden durchgehend gewässert und eine großzügige Beleuchtung der Alleen („Straßen“ würde es nicht treffen) sorgt auch nachts für eine Wohlfühlatmosphäre. Usbekistan war bis vor zwei Jahren übrigens das sicherste Land der Welt. Nach dem Tod des damaligen Ministerpräsidenten betreibt sein Nachfolger wohl schon wieder gefährliche Kontaktgespräche mit den No-Go-Areas drumherum, aber er ist dennoch sehr beliebt, weil er eine Unmenge an Neubauten auf den Weg gebracht hat und sich das Bruttosozialprodukt langsam erholt. Die Bestechung ist allerdings wieder im Vormarsch (Platz 157 von 180 Ländern bei „Transparency International“) und die Bevölkerung wird an einer sehr kurzen Leine gehalten. Pressefreiheit gibt es schon gar nicht – viele Journalisten schauen sich das Land durch das Fenster ihrer Gefängniszelle an. Wir als Touristen merken zum Glück davon nichts, aber unsere Reiseleiterin (und meine Google-Nachforschungen) bestätigen das eben Geschriebene.
Wir fahren also zurück ins Hotel, das immer noch keine Zeit gefunden hat, mein Zimmer zu machen. Ich gebe ihnen eine letzte Chance, solange ich runter an die Hotelbar gehe, um bei einem Glas Gin Tonic den Tagesablauf zu notieren.
OK, das mit dem Gin Tonic war nichts. Es gibt kein Tonic-Water in Usbekistan – jedenfalls nicht in diesem Vier-Sterne-Hotel. Wir haben versucht, mit den vorhandenen Softdrinks irgendetwas Vergleichbares zu kreieren – war aber nichts. Ein Tuborg-Bier muss jetzt für die nötige Bettruhe sorgen. Tut es. Jedenfalls das Dritte.
Der dritte Tag
Um 5:30 Uhr Ortszeit bimmelt mich mein iPhone aus dem Tiefschlaf. Also rund 24 Stunden nach meiner Ankunft müssen wir das Hotel wieder verlassen. Vielleicht räumt ja jetzt irgend jemand das Zimmer auf. Ein puritanisches Frühstück (Kaffee, Banane und ein Joghurt) muss reichen. Was anderes gibt es um diese Uhrzeit auch gar nicht.

Beim Auschecken bekommen wir einen kleinen Zettel abgestempelt, der Ort und Dauer unseres Aufenthalts dokumentiert und für die Ausreise im Pass abgelegt werden muss. So prüft der Staat, ob wir vielleicht heimlich irgendwo hingefahren sind, wo man nicht hin darf. Vielleicht prüfen sie auch nur, ob die Hotels ihre Einnahmen ordentlich angeben.
Heute geht es mit dem Zug nach SAMARKAND. Unser Bus kommt relativ pünktlich um halb sieben. Und mit ihm eine neue Reiseleiterin. „Lina“ ist um die sechzig, Russin, wohnt aber schon seit 30 Jahren in Usbekistan. Mit ihrer Kurzhaarfrisur, ihren harten Gesichtszügen und Ihrer schnarrenden Stimme im Befehlston könnte sie sehr gut eine russische KGB-Agentin in einem James-Bond-Streifen abgeben. Vor allem aber ist sie müde, was für Reisebegleiter in diesem Land ein Dauerzustand zu sein scheint. Die letzte Reisegruppe hat sie erst um zwei Uhr zum Flughafen gebracht. Als erste Amtshandlung sammelt sie Trinkgelder für unseren Busfahrer ein. Ich gebe 50.000 Euro, quatsch SO´M, wie hier die Währung heißt. Das sind knapp 5 Euro und für ein Trinkgeld eigentlich viel zu hoch. Aber egal, kleinere Scheine habe ich sowieso nicht. Am Bahnhof werden wir mit unseren Koffern wie auf einem Flughafen kontrolliert, wenn auch nur sehr lasch. Es sind inzwischen schon wieder 20 Grad mit der Tendenz nach oben.
Unser Zug ist natürlich pünktlich und hochmodern. Er ist bereits eine halbe Stunde vor der Abfahrt eingelaufen. Wir fünf „Externen“ sind auch hier wieder vom Rest der Gruppe isoliert und sitzen in einem eigenen Abteil, direkt neben dem Bordrestaurant. Gerade als ich überlege, dieses aufzusuchen, um vielleicht doch noch was Frühstücksmäßiges zu bekommen, rollt wie im Flugzeug ein Servicewagen vorbei. Die freundliche Bedienung versorgt uns mit einem Becher heißen Wassers und einer Tüte mit lauter feinen Dingen: Kaffeepulver, Teebeutel, Milchpulver, Zucker, Löffel, Reinigungstuch und vor allem einem „Würstchen im Schlafrock“. Damit ist der erste Hunger erst einmal gestillt. Und umsonst war´s auch noch.
Die Bahn kommt genau zwei Stunden und 11 Minuten später pünktlich in SAMARKAND an. Das ist eine Stadt mit etwa 300.000 Einwohnern. Außerdem gibt es hier gleich zwei der bedeutendsten Bauwerke aus alten Zeiten zu sehen. Da wäre zum einen das Grab eines grausamen antiken Feldherren namens Amir Temur, der gerne mal Pyramiden aus Menschenschädeln errichten ließ. Hier lag er nun, zusammen mit seinem Sohn und Nachfolger, der wiederum von dessen Sohn geköpft wurde, weil er die Macht nicht an seinen Nachwuchs weitergeben wollte. Waren schon wilde Zeiten damals. Das Grabmal sieht eigentlich der Moschee von gestern ziemlich ähnlich. Ich kann mich aber auch täuschen, weil sich diese Riesenbauwerke alle irgendwie ähneln.

Die nächste Sehenswürdigkeit sieht wieder fast genauso aus. Nur handelt es sich diesmal um eine ehemalige Koranschule, genauer gesagt, mal wieder um eine Moschee mit diversen Nebengebäuden. Das riesige Gelände heißt „REGISTAN“. Wir verbringen gut eineinhalb Stunden in den vielen unterschiedlichen Gebäuden, lauschen einheimischen Musikern, besuchen Dutzende kleine Läden mit Handarbeiten, staunen über die schiefen Türme (Der Untergrund verschiebt sich ständig!) und warten auf das Mittagessen, das tatsächlich eine sehr angenehme Überraschung mit sich bringt. Für umgerechnet sieben Euro bekommen wir mehrere Vorspeisen, eine Hauptspeise und den obligatorischen Nachtisch. Ich habe keine Ahnung, was ich da alles gegessen habe, aber es war lecker. Es war viel durchgekochtes Gemüse dabei, Hackfleisch vom Hammel und Rind und sehr schön feste Kartoffeln. Dazu ein eiskaltes Bier vom Feinsten. Das mit dem Wein lasse ich hier mal besser sein…
Nach dem Essen lernen wir endlich unser neues Hotel kennen. Wundersamer Weise passen wir alle rein. Es heißt „KARVONS HOTEL“ und ist eine Bruchbude.

Mein Einzelzimmer direkt unter dem Dach ist so groß wie eine Gefängniszelle. Die Stromleitungen sind auf die Wände aufgetackert, der Fußboden besteht aus sich auflösendem Laminat. Der Kleiderschrank hat keine Knöpfe zum Öffnen mehr. Die Vorhänge lassen sich nicht lichtdicht verschließen und die Batterie der Fernbedienung für die Klimaanlage ist leer. Die Dusche ist undicht, sodass das gesamte Duschwasser unter der Duschwanne wieder hervorkommt und das gesamte (kleine) Bad unter Wasser setzt. Das Waschbecken ist nur auf den Untersatz aufgelegt und das Klo kippt nach vorne, wenn man sich draufsetzt. Dass das Türschloss verkehrt herum eingebaut wurde und die Klobrille jeden Moment abbricht, spielt da nur noch eine periphere Rolle. In anderen Zimmern fehlt mal ein Nachttisch oder eine Nachttischlampe. Die Deckenleuchten kann man vom Bett aus nicht ausschalten und die Schalter befinden sich ca. 50 cm über dem Boden neben der Eingangstür. Der Hammer aber ist, dass die Betten nur teilweise bezogen sind! Jawohl, es gibt eine Art Kissen und auch ein Bettlaken Der Bezug der Bettdecke liegt allerdings zusammengefaltet am Ende des Betts. Außerdem ein weiteres Laken und eine Überdecke. Diese Do-it-Yourself-Philosophie in der Gastronomie ist mir neu. Natürlich steht auch keine Wasserflasche bereit, was das Zähneputzen zu einem nicht geringen Risiko macht. Das ganze Gebäude sieht zwar von außen wunderbar aus, hat aber innen an allen Ecken und Enden größere Macken. So sind die Stufen im Treppenhaus (natürlich gibt es keinen Lift!) unterschiedlich hoch, was einen gerne zum Stolpern bringt. Alle Schalter und Steckdosen sind auf unterschiedlicher Höhe angebracht und in der Regel auch nicht im rechten Winkel, sondern mal nach links, mal nach rechts drehend. Ich habe das Gefühl, die noch recht jungen Inhaber des Hotels haben den Kasten selbst zusammengebaut, nachdem sie ein paar Stunden in der Lehre waren.
Wir haben nicht viel Zeit, uns zu beschweren, denn das Programm geht weiter. Der Besuch einer Seidenteppichmanufaktur steht im Plan. Also mal wieder eine Kaffeefahrt, sollte man meinen. Aber der afghanische Verkäufer, Abdullah, der während des Afghanistan-Krieges in einer deutschen Schule ein hervorragendes Deutsch gelernt hat, macht seinen Job mit einem solchen Spaß, dass er damit als Comedian auf Tour gehen könnte. Er ermuntert uns sogar, die Muster der Teppiche abzufotografieren, damit wir zu Hause am Wochenende in unserer Freizeit einen eigenen Teppich knüpfen könnten. Im Grunde ist die Show nicht anders als bei meinen beiden Besuchen in der Türkei, aber Abdullah macht es einfach bedeutend symphatischer. 1000 Leute werden hier im Laufe eines Tages durch die Räume geschleust, in allen Sprachen dieser Erde. Darunter auch Putin, Steinmeier und Hilary Clinton. Die Bilder scheinen jedenfalls echt zu sein.
Natürlich kauft sich keiner einen Teppich, was bei Preisen ab 1000 Dollar für Kleinkram bis hin zu 100000 Dollar für besonders edle Teile auch kaum verwunderlich ist. Die Zeit der Orientteppiche ist – zumindest in Deutschland – vorbei, obwohl meine Mutter nach wie vor von der Langlebigkeit dieser Produkte (im Vergleich zu meinen Autos) überzeugt ist.
Also wieder zurück ins Hotel. Kurz frisch machen. Dann schon wieder Essen. Diesmal nicht so dolle. Alles geht rasend schnell, als wollte man uns sofort wieder loswerden. Das Essen gleicht dem vom Mittag, ohne jedoch genauso gut zu schmecken. Salz fehlt z.B. völlig. Da unsere 39-köpfige Gruppe sich so langsam auf der Straße wiedererkennen würde, bilden sich inzwischen auch kleine Grüppchen. Wer sind denn die Leute, mit denen ich durch das wilde Usbekistan reise? Wir sind wohl sieben Alleinreisende und 16 Paare, bis auf einen Ausrutscher fast allesamt gut jenseits der sechzig. Gefühlt manche schon eher achtzig. Eine Dame aus Bad Nauheim läuft wegen Hüfte/Knie mit zwei Stöcken, ein Herr aus Krefeld wegen Kreuzkaputt mit nur einem Stock, dafür nur in Trippelschrittchen rum. Er ist aber auch schon 81. Seine Frau ist sehr viel jünger. Chapeau! (Für ihn, nicht für die Frau!). Der älteste Mitreisende ist gar 88 Jahre alt. Die Herren haben bis auf wenige Ausnahmen Übergewicht, die Damen nur zum Teil. Man kommt aus ganz Deutschland, natürlich auch aus dem Osten Deutschlands. Unser Youngster, Andreas aus Augsburg, bringt die Truppe immer gerne wieder in Schwung. Fünf Raucher (darunter auch Andreas) stehen regelmäßig vor den Restaurants auf der Straße, um ihr mitgebrachtes Qualmzeug zu rauchen. Alex hat so eine moderne Computerzigarette, die direkt nur den Tabak verbrennt und 30% weniger Schadstoffe haben soll. Wären mir immer noch 30% zu viel. Beim gemeinsamen Essen oder abends auf der Hotelterrasse kommt man sich näher und erzählt aus seinem Leben. Bis jetzt gab es keine Querköpfe oder Unsympathen in der Gruppe. Mit allen lässt es sich gut aushalten. Das mag daran liegen, dass meine Toleranzschwelle im Laufe der Jahre gesunken ist oder dass es sich wirklich um nette Leute handelt. Der Slogan von „Trendtours“ lautet ja: „Verreisen mit netten Leuten“. Ich nehm´s wie´s ist und schiele nur ein ganz klein bisschen neidisch auf die italienische Reisegruppe, die wir auch ständig überall wiedersehen. Da sind wirklich vier Generationen zusammengewürfelt.

So, inzwischen haben wir aufgegessen und fahren mal wieder mit dem Bus ins Hotel. Da vor dem REGISTAN (diese Moscheeähnliche Koranschule) heute Abend eine Open-Air-Veranstaltung mit berühmten Sängern (Oper), einem riesigen Live-Orchester und einer wahnwitzigen Lightshow stattfindet, machen wir da für einen Teil von uns nochmal halt und schauen uns das Spektakel aus 50 Meter Entfernung an. Tolles Orchester, toller Sänger. Tolle, schöne Menschen beiderlei Geschlechts säumen den Platz und die Wege. Toller Abschluss des dritten Tages. Die dreihundert Meter bis zum Hotel laufe ich zu Fuß. Und weil alles so schön ist, setze ich mich noch in den Hotelgarten und will ein bisschen an diesem Text feilen. Aber da kommen schon die anderen ebenfalls von dem Konzert zurück, setzen sich zu mir und helfen mir, eine weitere Flasche Bier zu leeren. Danach wird es richtig kalt und Zeit für die Heia.
Da die Klimaanlage immer noch läuft, ist es auch im Zimmer jetzt sehr kalt. In Verbindung mit der fehlenden Bettdecke habe ich eine sehr unruhige Nacht mit sehr merkwürdigen Alpträumen. Aber die behalte ich besser für mich.
Der vierte Tag
Sechs Uhr dreißig Wecken. Das geht ja noch. Ich bin froh, mich wieder anziehen zu dürfen. Im Bad wieder der Schock mit dem austretenden Duschwasser. Ich bin heute irgendwie sehr langsam und komme erst fünf Minuten vor der Abfahrt ins Frühstücksrestaurant. Dort sitzen noch einige unserer Tour-Teilnehmer und jammern vor sich hin. Den Kaffee kann man nur einzeln beim Kellner bestellen. Mit ein bisschen Glück bekommt man ihn dann eine Viertelstunde später, da er in einer Espressomaschine hergestellt wird und nur tropfenweise aus dem Gerät kommt. Also Tee. Teebeutel, genauer gesagt. Brot gibt es nicht mehr. Aber noch zwei Scheiben Wurst und ein Mini-Bockwürstchen. Käse: Nein danke. Eier? Schon lange aus. Butter hätten wir noch. Und Gulasch mit Kartoffeln, das langsam aber sicher in die Tage kommt und besser an die Hühner verfüttert werden sollte. Vier Stewardessen und zwei Piloten kommen auch mit mir zum Frühstück. Auch für sie gibt es nichts mehr. Ich möchte kein Fluggast sein, der von dieser Crew heute geflogen wird. Gerade als ich aufgeben will, kommt einer der beiden Jungs zurück von einem Lebensmittelgeschäft auf der anderen Straßenseite und bringt eine große Tüte mit Äpfeln mit, von denen ich mir einen ergattern kann.
Und damit beginnt unser Mammutprogramm für diesen Tag. Ich habe meine Kleidung den anderen Herren angepasst und auch auf “Kurze Hose“ umgestellt , weil es ja nun wirklich jeden Tag wunderbar warm wird.
Wir beginnen zur Abwechslung mal mit dem Besuch einer Seidenpapierfabrik. Fabrik ist nicht das richtige Wort, da das teure Seidenpapier hier von Hand hergestellt wird. Ein paar clevere Usbeken haben sich das Geheimnis der Herstellung patentieren lassen und beliefern inzwischen Behörden im In-und Ausland mit diesem widerstandsfähigen, fast unzerreißbaren dokumentenechten Papier. Wir schauen uns die Herstellung an und bekommen dafür auch noch ein Schälchen Tee gereicht. Die Zuckerwürfel haben übrigens die Form eines Seidenraupencoupons. Während der vier Touristenmonate (April/Mai und September/Oktober) ruht die Produktion. Dann läuft nur ein Touri-Programm mit diesen interessanten Vorführungen. Da das Papier mit den Blättern des Maulbeerbaums produziert wird, stehen auch hunderte dieser Bäume zum „Ernten“ um die Produktionsstätte herum. Außer Papier kann man noch eine Menge anderer Dinge mit dem Verfahren herstellen: Taschen, Mäntel, Kleidung, Püppchen und jede Menge Schnickschnack. Wir kaufen nix und fahren weiter.

Ein antikes Planetarium steht auf dem Programm. Irgendein Krieger, der sich sehr für Astronomie interessierte, hat monatelang nach einer Art Himmelsfernrohr gesucht und schließlich auch gefunden. Das Gestell für dieses Riesenmonster wurde in zwei halbrunden Aussparungen ca. 15 Meter unter der Erde hin und her bewegt (von entsprechend ausgebildeten Sklaven vermutlich, denn das Ding muss sehr, sehr schwer gewesen sein!). Der Lichtschein der Himmelskörper spiegelte sich dann auf dem Boden des „Objektivs“ (oder wie immer man das nennen soll). Auf diese Weise hat der feine Herr rund 1600 Sterne entdeckt, bzw. deren Laufbahn genau beschrieben. Die Abweichung betrug nur +/- ein Grad! Neben der Ausgrabung gibt es auch noch ein modernes Museum, in dem man noch sehr viel mehr über die Technik dieser Himmelsentdeckung erfahren könnte, wenn uns nicht der Tagesplan zum nächsten Veranstaltungsort getrieben hätte: Ein Mausoleum.
Nein, nicht EIN Mausoleum. Eine ganze Straße voller Mausoleen. Alle mindestens so groß wie ein dreistöckiges Haus. Wie überall, auch hier mit blauen Mosaiken verziert. Man darf die Räume sogar betreten, aber außer einem Steinklotz in Form eines Sargs ist da nicht viel zu sehen. Auf manchen Sarkophargen liegen sogar dicke Geldbündel drauf, obwohl dies verboten ist. Erstaunlicherweise scheint sich keiner zu trauen, dieses Geld zu mopsen.
Nach dem Mittagessen, an das ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann, geht es weiter zu einer kaputten Moschee namens Bibi-Chanum. So langsam bringe ich die vielen Moscheen durcheinander. Ein paar werden noch benutzt, andere dienen als Basar. Es sind auf jeden Fall zu viele. Auf einem der vielen Basare beenden wir das heutige Programm. Was gibt es zu kaufen? Einfach gesagt: Nichts, was wir wirklich brauchen. Fellmützen für den Winter wären zwar zu erwägen, aber mit den hunderttausenden von Seidenschals jedweder Qualität kann ich nichts anfangen. Sie stehen mir einfach nicht.
Auch heute bekommen wir wieder ein wunderbares Abendessen. In der Regel besteht so ein Mahl aus drei bis vier Vorspeisen (Gekochtes Gemüse, Salate, irgendwas Undefinierbares), einer Suppe, einer Hauptspeise und einem Nachtisch. Wasser ist frei, aber die Getränke, meist Bier, müssen wir selbst bezahlen. Was bei ca. 2 Euro für 0,5 Liter auch nicht schwer fällt.

Zurück in unserem Bruchbudenhotel bildet sich noch eine Gruppe von ca. zehn Teilnehmern, die den Tag bei fröhlichen Gesprächen ausklingen lassen wollen. Leider gibt es nur insgesamt 8 kalte Biere. Danach nur noch warme. Mit einer improvisierten Eistruhe lässt sich das Problem immerhin teilweise übergehen.
Der fünfte Tag
Das Frühstück ab sieben Uhr gestaltet sich wie gewohnt sehr einseitig. Statt Kaffee aus der Espressomaschine gibt es heute Kaffeepulver und heißes Wasser. Sonst gibt es fast nichts mehr, als ich hinzustoße. Unsere Reiseleiterin, Oberst Lina, hat erst gegen Mitternacht ein Hotel gefunden. So lange hat man sie hingehalten, dass doch noch etwas frei werden würde. Die Zettel für die Aufenthaltsbestätigung sind ebenfalls noch nicht gedruckt. Gleich zwei Crews der Usbekischen Fluggesellschaft „Usbekistan Airlines“ befinden sich in lautstarken Streit mit der Geschäftsleitung. Aus nahezu allen Duschen tropft das Wasser inzwischen durch die Decke nach unten.
Wie kann man so ein Juwel so in den Keller fahren? Das Gebäude ist sehr schön, modern und extrem gut gelegen, nämlich nur 10 Minuten zu Fuß von der größten Touristenattraktion, dem Registan, entfernt. Das Restaurant bräuchte nur ein wenig Licht und weniger dunkle Teppiche an den Wänden. Die Zimmer ließen sich für vergleichsweise wenig Geld wieder in Schuss bringen. Was fehlt, ist ein Manager, der Ahnung vom Hotelbetrieb hat und in der Lage ist, Personal zu führen. Ach so, das Personal sollte auch aus der Branche kommen, sonst dauert es ja ewig.
Egal – das ist nicht unser Problem. Wir verlassen diese ansonsten wunderschöne Stadt mit diesen wunderschönen, sehr freundlichen Menschen und haben eine Tagesreise mit dem Bus vor uns. Heute Abend wollen wir in Bughara sein, 130.000 Einwohner.

Die Fahrt im Bus ist recht beschwerlich, da die Straßen in keinem wirklich guten Zustand sind. Es gibt immer mal ein paar Kilometer, auf denen unser Fahrer Gas geben kann, aber in der Regel schleicht er nur so um die Schlaglöcher. Zu sehen ist wenig. Hie und da ein landwirtschaftlicher Betrieb, in der Regel nur Wiesen und Bäume (Die brav einen weißen Baumstamm angemalt bekommen haben).
Zwischendurch müssen wir einen Nothalt durchführen. Einer der Gäste hat ein Malheur mit seiner Hose gemeldet. Auf deutsch: Er hat reingeschissen und ist damit das erste Opfer der ängstlich erwarteten Magen/Darm-Grippe, die einen hier leicht befallen kann.
Um die Hose wechseln zu können, muss der Fahrer zunächst seinen Koffer aus dem Bus fischen. Dann dackelt der Ärmste so weit es geht von dem Bus weg, um hinter einem Busch den Rest seines Geschäfts zu machen und dann mit neuer Hose (die alte hat er gleich weggeworfen) wieder zurück in den Bus zu kommen.
Shit happens.
Immerhin ist unser Kommandeur Lina nun in ihrem Element, weil wir ihr ja im Bus nicht weglaufen können. Sie erzählt uns lustige Geschichten aus lustigen Büchern, die von einer Art Till Eulenspiegel handeln. Ihre Laune bessert sich auch deshalb, weil wir in Richtung Heimat fahren. Lina ist ja vor 30 Jahren aus Russland nach Bughara versetzt worden, um den Kindern russisch beizubringen, wie wir jetzt schon das dritte Mal hören.
Das Mittagessen findet bei einer Familie zuhause statt. Ja, so ist es. Viele Familien sind Großfamilien mit sehr großen Häusern, Räumen oder Innenhöfen, in denen sie normalerweise ihre Hochzeiten feiern. Eine Hochzeit mit 200 Leuten ist geradezu popelig, so ab 1000 gehört man dazu. Und weil man sonst mit den riesigen Höfen nicht viel anfangen kann, vermietet man sie an Touristen zum Mittagessen. Das Ganze wird wohl auch kontrolliert, so dass man sicher sein kann, dass mit dem Essen alles in Ordnung ist. Ist es das wirklich? Am Nachmittag haben wir nämlich schon ein zweites Opfer. Wir kommen uns vor wie bei Agatha Christies „Zehn kleine Maximalpigmentierte“ (Negerlein). Wen wird es noch treffen?
Mir geht es weiterhin magenmäßig ausgezeichnet. Nur mein Schnupfen wird immer stärker, was wohl daran liegt, dass ich meine Allergietabletten nicht genommen habe. Und warum habe ich die nicht genommen? Weil ich die zusammen mit meiner ganzen Reiseapotheke im Hotel in Taschkent im Bad liegen gelassen habe. Wenn meine Ärztin das liest, bekommt sie sicher einen Schreikampf. Aber keine Angst, Anna, ich lebe noch und habe auch inzwischen Ersatzmedikamente besorgt, die z. B. meinen hohen Blutdruck senken sollen. Da wir am Samstag nochmal in Taschkent übernachten werden, kann ich mir meine Reiseapotheke aber am vorletzten Tag wieder in dem Hotel abholen, in dem sie inzwischen gefunden und für mich aufbewahrt wird.

Nach dem Essen stehen uns weitere fünf Stunden Busfahrt bevor. Füllen wir sie mit ein paar interessanten Facts.
Usbekistan hatte 2017 erstmals eine Million Touristen. Das Land ist 447 qkm groß, genauso groß wie Schweden. Aufgeteilt ist es in 12 Provinzen und eine Sonderprovinz rund um den ARAL-See. Den dürfen wir übrigens nicht besuchen, weil er streng bewacht wird. Drei Länder haben Zugriff auf das lebenswichtige Wasser des Sees. Leider entnehmen alle Länder soviel Wasser wie es nur irgendwie geht, so dass der Grundwasserpegel inzwischen gefährlich gesunken ist. Was passiert, wenn das Wasser alle ist, möchte ich mir nicht in meinen schlimmsten Träumen vorstellen. Dass das ohne Krieg geregelt wird, halte ich für ausgeschlossen. Danke, Nestlé & Co!
Geschrieben wird sowohl in lateinischer als auch kyrillischer Schrift, obwohl die seit 1991 nicht mehr gelehrt werden darf. Die Grundschule und die weiterführende Schule sind kostenlos, ab der Universität kostet der Unterricht aber Geld. Die Schule dauert mindestens neun Jahre. Man lernt ab der zweiten Klasse russisch und ab der dritten wahlweise deutsch oder englisch. Tatsächlich sprechen viele junge Usbeken ein gerade so brauchbares Englisch. Deutsch sprechen nur manche Kellner. 65% der Bevölkerung lebt auf dem Land und von der Landwirtschaft. Während es früher normal war, bis zu zehn Kinder zu bekommen, versucht man inzwischen, die Frauen diskret auf moderne Verhütungsmethoden einzustimmen. Mit Erfolg: Die Geburtenrate ist auf 3,8 Kinder zurückgegangen. Auch noch ´ne Menge, aber die Richtung stimmt ja. Und das Land hat viel Platz. 90% aller Usbeken sind Muslime. Allerdings läuft hier (fast) niemand verschleiert herum. Es ist ein – zumindest für unsere Augen – sehr freies tolerantes Miteinander zu beobachten. Wenn man als Europäer in so ein Land kommt, bekommt man ein ganz leichtes Gefühl davon, was es heißt, ein Fremder zu sein. Noch sind wir willkommene Fremde, weil wir ja auch gleich wieder abreisen. In Spanien ist es schon gekippt. Auf Mallorca wehren sich die Einheimischen inzwischen lautstark gegen die vielen deutschen und englischen Touristen, die ihre schöne Insel überrollen und hier billig überwintern. Aber ich schweife ab.

Wir sind nämlich inzwischen in Bughara angekommen. Bis auf den Kern der Altstadt wurden vor zwei Jahren alle Gebäude abgerissen und außerhalb wieder neu aufgebaut, natürlich in „modern“. Da steht da jetzt ein Haus neben dem anderen, ohne dass man auf den ersten Blick einen Unterschied zwischen den Häusern erkennen kann. Es gibt auch moderne Geschäftsstraßen, breit und großzügig angelegt mit Alleenbäumen. Wie gesagt, wurde das alles innerhalb von zwei Jahren von der (neuen) Regierung durchgezogen. Wahrscheinlich mit dem Erlös der riesigen Gasvorkommen, die es hier im Lande gibt.
Wir schauen uns die Neustadt aber gar nicht erst an, sondern halten kurz an unserem neuen Hotel „Alibaba“. Um Kalauern vorzubeugen: Es gab keine Räuber, schon gar keine vierzig. Der etwas ältere Kasten war sehr gemütlich eingerichtet. Die Zimmer zwar klein, aber zweckmäßig, die Betten knochenhart, Klimaanlage, Telefon, Fernseher – alles vorhanden. Man kann sogar die Fenster öffnen, weil Fliegengitter daran befestigt sind. Bei der Gelegenheit: Insekten scheint es auch hier nicht mehr zu geben. Ein paar Fliegen, das ist alles. Nachdem wir alle ausgepackt und uns frisch gemacht haben, fährt uns der Bus schon weiter in die Altstadt, bzw. vor die Tore derselben. Wir laufen ein paar Meter und sind plötzlich mitten in einem Touristenparadies. Ein kleiner künstlicher Teich wird umrandet von Speiselokalen, und die daran anschließende Flaniermeile beherbergt Dutzende von Geschäften mit dem üblichen Touristenkrempel. Aber auch mehr, wie sich bald herausstellen wird. Natürlich stehen irgendwelche Moscheen in Reichweite rum, aber darum geht es heute Abend ja nicht. Wir sind zu einem Abendessen in einem jüdischen Haus aus dem 19. Jahrhundert verabredet. Das Essen gehört zur gebuchten Halbpension, die Biere kosten 20.000 So´m, also 2 Euro für 0,5 Liter. Wie (fast) überall. In unserem neuen Hotel wandert die Flasche schon für 7.000 über die Theke, also rund 70 Cent. Die Beschreibung des Essens kann ich mir ab jetzt schenken, da es doch immer auf dieselbe Speisefolge hinausläuft. Lecker ist es immer, aber ist es auch bekömmlich? Wir haben inzwischen schon drei Ausfälle…
Nach dem Essen bringt uns der Bus wieder brav ins Hotel zurück. Es ist erst neun Uhr, sodass sich ein paar Unbeirrbare noch zu einem weiteren Bierchen im Innenhof des Hotels treffen. Ich gehöre natürlich auch dazu, verschwinde aber vor der zweiten Runde.
Der Schlaf auf dem knochenharten Bett ist recht ungewohnt, ich werde zigmal wach.
Der sechste Tag
Wie die Zeit vergeht. Wir haben schon mehr als die Hälfte hinter uns. Jetzt haben wir aber erst einmal sehr viel vor uns. Also nicht alle. Inzwischen haben wir schon FÜNF Magenkranke. Der gesunde Rest hakt nun zu Fuß folgende Sehenswürdigkeiten ab:
- Ein superhohes Minarett, das auch nachts hübsch leuchtet.
- Eine Koranschule
- Ein Geschäft für gewebte Seidenstoffe (inkl. Toilettengang)
- Ein Basar mit allem, was man nicht braucht
- Eine russische Kirche
- Eine weitere Koranschule (es gibt davon 32 Stück, aber nur diese ist in Betrieb!)
- Ein Geschäft für ultrascharfe Messer und Klingen (gut fürs Handgepäck im Flugzeug
- Ein deutsches Cafe, das von einer Mannheimerin geführt wird
- Einen weiteren Teppichladen
Dann gibt es endlich mal wieder was zu Essen, diesmal direkt an dem kleinen Wasserbecken im Zentrum. Am Nachmittag stehen dann noch folgende Programmpunkte auf dem nicht enden wollenden Programm:
- Eine Moschee (in Betrieb) mit 20 Holzsäulen
- Ein weiteres Mausoleum.
- Ein Laden mit Handpuppen und entsprechender Vorführung
- Eine Teepause (!)
Diese Pause nutze ich, um mir endlich eine usbekische SIM-Karte zuzulegen. Einer der Handpuppenspieler hat mir nämlich verraten, wo ich sie bekomme. Wer nicht weiß, was eine SIM-Karte ist, möge bitte seine Kinder fragen. Also tapere ich durch die schmalen Gässchen hinter der Touristenmeile, um das Geschäft zu finden. Ich finde leider nichts, auch nicht den Rückweg. Da sehe ich plötzlich einen uniformierten Mitarbeiter der UZ-Telekom mit seinem Rad vor mir. Ich spreche ihn an, aber er versteht nur Bahnhof, ist aber so freundlich, seine Frau rauszurufen, die des Englischen mächtig ist. Die sehr hübsche Usbekin sagt mir, es gäbe ein Geschäft namens „Market“, wo man meine Wünsche erfüllen könne. Und dann geht sie mit mir den langen Weg bis zur Touristenhauptstraße zurück, den ich alleine gar nicht gefunden hätte. Ich bin versucht, ihr ein Trinkgeld zu geben, aber das hätte sie sicher als unhöflich empfunden – sie wollte mir ja nur helfen. Also stehe ich da auf dieser Touristenmeile und suche einen „Market“. Eigentlich ist die ganze Straße ein Market, wie soll ich da herausfinden, wo es hier SIM-Karten gibt? Ich bin etwas verzweifelt, weil ich unseren vorletzten Programmpunkt, eine Folklore-Show mit Modenschau, nicht verpassen will. Plötzlich sehe ich das Schild „Market“, von oben nach unten geschrieben. Es scheint sich aber um einen Lebensmittelladen zu handeln. Egal, ich gehe rein und frage den Verkäufer nach einer SIM-Karte. Und siehe da: Er weist mich in eine Ecke des winzigen Ladens, wo eine rundliche, aber hübsche junge Usbekin, umringt von Bildschirmen und Laptops, das Telefongeschäft erledigt. Mein Wunsch nach einer SIM-Karte ist ihr nicht fremd. Sie fragt nach meinem Pass, den ich natürlich schon vorher aus dem Hotel mitgenommen habe. Und während sie die ganzen Daten meines Passes buchstabengetreu in ihren Rechner tippt, kommen ständig irgendwelche Einheimische, die ihre Telefonkarte aufladen wollen. Vermutlich geht das nicht automatisch über Bankkonten, sondern nur per Bargeld. Die Beträge, die da so eingezahlt werden, sind erstaunlich gering. Umgerechnet 20 Cent bis maximal 75 Cent werden da zum Auffüllen über die Theke gereicht.
Das Einrichten meiner SIM-Karte im iPhone geht dann erstaunlich schnell. Das Mädel hat zwar noch nie ein iPhone X gesehen, weiß aber genau, wo sie drücken muss, um die nötigen Zahlenkolonnen einzugeben. Nach zwei Minuten bin ich im Internet. Ich habe eine 4 Gigabyte-Karte gekauft und dafür unglaubliche 6,40 Euro bezahlt. Und das Schönste: Die UZ-Telekom schenkt mir als neuen Kunden noch weitere 4 Gigabyte dazu. Das sollte wohl für den Urlaub reichen.
Nur telefonieren kann ich mit der Karte nicht. Dafür habe ich aber das Programm „Satellite“ auf dem Telefon, mit dem man in der ganzen Welt kostenlos telefonieren kann, 90 Minuten pro Monat. Eine tolle Sache.

Die Folklore-Show hat schon angefangen. Vor vollem Haus in einer ehemaligen Moschee treten abwechselnd Models mit landestypischen Klamotten oder Tänzerinnen mit landestypischen Tänzen auf. Dazu spielt eine Live-Band, recht ordentlich sogar.

Nach sechzig Minuten ist der Spuk vorbei – es wird mal wieder Zeit, etwas zu essen. Unsere Reiseleiterin Lina (sie heißt tatsächlich sogar „Angelina“) hat sich ein Restaurant auf einem Dach ausgesucht, irgendwo in dem Viertel mit den vielen Moscheen, Minaretten oder Mausoleen. (Wer soll sich das alles merken?)
Leider, leider pfeift der Wind so kalt, so dass wir uns nacheinander in Tischdecken einwickeln, um nicht frühzeitig an Schwindsucht einzugehen. Zum Essen Bier und einen Wodka.
Und nach der Rückkehr ins Hotel wieder ein kurzer Plausch mit meinen Mitreisenden im Innenhof des Hotels – bei einem weiteren leckeren Bier.
So ein ereignisreicher Tag macht müde. Noch ein Stündchen E-Mails beantwortet und dann tief und fest geschlafen – trotz der Betonmatratze.
Der siebente Tag
Auch an unserem letzten Tag in dieser wunderschönen Stadt Bughara dürfen wir ausschlafen. Abfahrt ist erst um halb zehn. Als erstes besuchen wir mal wieder irgendein riesiges Grabmal. Außerdem gibt es hier wohl die einzige Frauenmoschee des Landes. Wir lernen, dass nur die Männer beten gehen. Die Frauen hüten derweil die Kinder, waschen die Wäsche und kochen das Essen. Wie es schon früher war. Und hier eben immer noch ist. Übrigens tragen die muslimischen Männer hier alle keine Bärte, was ihnen deutlich besser steht als diese angstmachende Islamisten-Haartracht bestimmter Volksgruppen, die es hier (derzeit) zum Glück nicht gibt.

Der nächste Programmpunkt ist das Haus eines ehemals sehr reichen Kaufmanns namens Faysulla. Es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, und Faysulla wurde schon lange aus irgendwelchen Gründen geköpft, aber man sieht es immer noch als etwas Besonderes an. Besichtigen können wir nur das Frauenhaus. Das Männerhaus ist schon zerfallen. Völlig klar, dass kein Mann diesen Frauenhof (und die zugehörigen Zimmer) jemals betreten durfte, ohne sein Leben auf unschöne Weise beenden zu müssen. Als wir da sind, dreht ein junges Brautpaar gerade einen Hochzeitsfilm für die buckelige Verwandschaft auf dem Lande. Wir sind Zeuge, wie die Braut Teig in den Ofen steckt und dann ein fertiges Brot wieder heraus nimmt. Die Backzeit wurde als Filmtrick einfach übersprungen. Sie legt das Brot ihrem Göttergatten zu Füßen und macht ihm schöne Augen.
Schöne Augen haben die Mädels hier fast alle. Das macht wohl der persische Einfluss. Bei den russischstämmigen Damen sieht es allerdings wieder anders aus. Die Mischung vielen verschiedenen Volksstämme hat jedenfalls im Schnitt wirklich absolut vorzeigbare Exemplare hervorgebracht. Infolge der vielen gebackenen Brote gehen die Damen und Herren allerdings im Alter wieder auf wie Hefe, aber ist wohl der Lauf der Dinge. Wenn man im Schlachthaus sitzt, soll man nicht mit Schweinen werfen.

Weiter geht´s zur Abwechslung mal wieder zu einer inaktiven Koranschule, die man inzwischen nur noch nickend zur Kenntnis nimmt. „Studiosus“-Reisende müssen da schon mal einen zweistündigen Vortrag in Kauf nehmen. Lieber schauen wir uns bei einem Kriegsmemorabilien-Händler um, der zentnerweise russische Orden und Pistolen, Messer und anderes Kriegsgerät anbietet. Hier findet man auch einige gut erhaltene Schwarz/weiß-Fotos aus der Zeit des russischen Reiches, zu dem dieses Land ja sehr lange gehört hat. Die ersten Mützenkäufe finden statt.

Ein paar Worte zur Wasserversorgung: Hier gab es früher mal 97 Teiche, die aber bis auf fünf zugeschüttet wurden. Warum? Nun, diese Teiche waren mit üblen Viechern kontaminiert, die es fertig brachten, sich im Körper des Menschen breit zu machen und bis zu 2 Meter lange Würmer zu bilden, die dann durch die Haut nach außen stießen. Das Rausziehen und Aufwickeln der Widerlinge musste langsam und sorgsam geschehen, damit sie nicht abrissen. Es soll gar fürchterlich gewesen sein. Heute ist das Wasser zwar nicht für jeden trinkbar, aber zum Zähneputzen durchaus zu verwenden.

Und schwupps – ist es schon wieder Zeit für das Abendessen. Wir essen in einem wunderbaren Restaurant in der Altstadt. Auch wieder im Freien, aber diesmal bei sehr angenehmen Temperaturen. Drei Vorspeisen, Suppe, Fleisch/Kartoffelgericht, Nachtisch. Dazu Bier und Wodka. Same procedure als every day. Eigentlich würde das Abendessen , also die mit der Reise bezahlte Halbpension, völlig ausreichen. Aber Lina hat einen Deal mit „ihren“ Restaurants ausgemacht, dass wir dort für nur 7.- Euro die oben aufgeführten Köstlichkeiten vorgesetzt bekommen. Und da kann man ja wohl kaum nein sagen. Manche tun es dennoch, wenn auch unfreiwillig. Die Zahl der Kranken ist auf über zehn gestiegen. Dafür haben sich aber die ersten Opfer auch schon wieder erholt. Irgendein einheimisches Teufelsmedikament wirkt wahre Wunder. Mir geht es immer noch bestens, auch wenn ich ein gewisses Völlegefühl nach dem Essen nicht verneinen kann und daher schnell zu Bette möchte. Der morgige Tag soll sehr hart werden.
Der achte Tag
8 Stunden Fahrt durch die Wüste stehen uns bevor. 8 Stunden mit zwei Pinkelstops und einer Mittagspause. Die Straße ist auf den ersten 50 Kilometern in einem desolaten Zustand, dann wird es besser. Wir fahren, als hätten wir eine deutsche Autobahn unter den Reifen. Um Zwölf gibt es bereits Mittagessen, Hammelspieße und Nudelsuppe. Über die Hälfte unserer Teilnehmer meldet sich krank und mümmelt stattdessen Brot mit grünem Tee. Wir wollen nach Chiva, das auch Xiva oder Shiva geschrieben wird.

Gegen 18.00 Uhr kommen wir schwer erschöpft in Shiva an. Unser Hotel ist das Schönste (und Neueste), das wir bisher auf dieser Reise hatten. Drei Geschosse, riesengroßer, toll angelegter Garten, nagelneue Zimmer mit einer allerdings gewöhnungsbedürftigen Inneneinrichtung. So verbergen sich hinter den Vorhängen völlig unbenutzbare Bücherschränke mit Glasböden. Und so langsam fallen uns weitere Dinge auf: Der einzige Fahrstuhl ist defekt, der einzige Geldautomat ist außer Betrieb, das Wechseln an der Rezeption ist nicht möglich, weil man kein Bargeld vorhält, und das Wasser ist absolut untrinkbar: 3 Kilogramm Lehm pro Kubikmeter können nicht gesund sein. Wenn im Bad Wasserflächen trocknen, sieht man keine Wasserflecken, sondern Mehlstaub. Leider ist man in meinem Zimmer auch sehr sparsam mit dem Toilettenpapier. Egal, es ist trotzdem das Schönste Hotel von allen. Und daher sind wir auch sehr zufrieden. Das Abendessen gibt es ebenfalls hier im Speisesaal. Danach ist mein Akku ziemlich leer und ich will schnell ins Zimmer, um mich auszuruhen. Leider hindern mich diverse dringende Mails daran, das doch wieder knochenharte Bett vor 23.00 Uhr zu besteigen.
Um halb vier hatte ich dann endlich das Bedürfnis für ein Bedürfnis, um das mal freundlich zu umschreiben. Leider war aber – wie schon erwähnt – nicht genügend Toilettenpapier vorhanden, um das Geschäft erfolgreich abzuschließen. Also rief ich den Nachtportier an und schilderte ihm meinen Mangel. Brav brachte er mir eine neue Rolle ans Zimmer.
Das Frühstück war durchwachsen, aber annehmbar. Einige von uns hatten den gestrigen Abend bereits genutzt, sich die touristische Attraktion von Chiva anzusehen, aber jetzt waren wir alle bereit für eine der größten Sehenswürdigkeiten unserer Tour. Nein, nicht alle. Eine der Damen hatte bereits den Notarzt rufen müssen und bekam Infusionen.

Was ist das für eine Sehenswürdigkeit in Chiva? Eine kleine Stadt wie aus 1001 Nacht, nur in echt. Umhüllt mit einer hohen Stadtmauer, ist das Dorf nur etwa 700 mal 400 Meter groß. Drum herum gibt es eine mittelgroße Stadt mit ca. 70.000 Einwohnern. Auch hier sauber gefegte Straßen, egal, wo man hinschaut. Andreas hat beobachtet, dass ein Einheimischer ein Blatt vom Boden aufhob und zu einem der vielen Müllbehälter trug. Hat so was schon jemals jemand in Frankfurt auf der Zeil gesehen?
Ein Ersatzbus fährt uns die paar Meter zum Eingang. Unser Bus soll einen Schaden haben, der heute repariert werden soll. Eigentlich hätten wir auch laufen können, aber da unsere Gruppe aus lauter Halbgreisen besteht, war das der sicherere Weg.
Wir betreten die „Stadt in der Stadt“ durch das Osttor der Außenmauern und staunen. Innen befinden sich natürlich die üblichen Moscheen, Minarette und Mausoleen, aber auch ein Harem. Die „Großkopferten“ durften damals vier Hauptfrauen halten. Dazu noch jede Menge Konkubinen, also junge Mädels. Die Hauptfrauen hatten eigene Gemächer, durften die Kinder kriegen und waren auch sonst hoch angesehen. Die bis zu vierzig Konkubinen mussten es sich auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes bequem machen – den ganzen Tag dem Sonnenlicht ausgesetzt und auch sonst nur Frauen zweiter Wahl, falls der Hausherr mal Appetit auf was Neues hatte.
Wir könnten ein Minarett besteigen, aber dazu hat keiner Lust. Der Ort wird von lauter kleinen Händlern bevölkert, die den üblichen Krimskrams anbieten. Natürlich laufen uns auch wieder Brautpaare über den Weg. Erstmals sehen wir die Feierlichkeiten anlässlich einer Beschneidung eines bedauernswerten Jungen. Ob er weiß, was gleich mit ihm gemacht wird? Er guckt immerhin ziemlich gequält.

Einige Moscheen oder Mausoleen später gibt es Mittagessen. Der Nachmittag steht zu unserer freien Verfügung. Ich nutze die Freizeit, um mich mittels Google Maps wieder ins Hotel zu lotsen und schreibe ein bisschen an diesem Blog weiter. Um 18.00 Uhr werden wir schon wieder abgeholt, diesmal mit „unserem“ Bus. Wohin? Natürlich zum Essen. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr, zwinge mir aber doch das eine oder andere Teil hinter die Kiemen. Ich habe eine Riesenangst vor meiner Waage zuhause…
Nach dem Essen wieder zurück ins Hotel und mein täglich Brot verdient. Dann Heia. Wecken um 5:30 Uhr!
Der neunte Tag
Das Ende der Reise kommt näher. Nach dem Wecken, Aufstehen, Frühstücken und Transfer zum Flughafen in eine kleine, ca. 30 Kilometer entfernte Stadt checken wir zum Flug zurück nach Taschkent ein. Hier hat die Reise begonnen, hier wird sie enden. Auch dieser Flug findet in einem Airbus A320 statt, nahezu vollbesetzt. Nach nur etwa einer Stunde und zwanzig Minuten Flugzeit landen wir wieder da, wo sich anfangs keiner um uns gekümmert hat. Es ist diesmal ähnlich. Der Bus mit dem Schild „Trendtours“ steht zwar auf dem Parkplatz, aber der Fahrer will nichts mit uns zu tun haben. Er reinigt in Seelenruhe ein ausgebautes Sitzkissen mit Bürste und Seife. Lina ruft verzweifelt die Zentrale an. „Unser“ Bus liegt irgendwo mit einem Schaden auf der Straße und wird nicht kommen. Der vorhandene Bus ist eigentlich tatsächlich für eine spätere „Trendtours“-Gruppe geplant, aber durch den Ausfall muss er jetzt einspringen. Etwas widerwillig baut er das Sitzkissen wieder ein und räumt die Koffer in das Transportfach. Endlich fahren wir wieder in die Stadt. Bevor wir uns noch ein paar Plätze anschauen müssen, wird unsere Schwerkranke ins Hotel gebracht. Der Arzt ist informiert. Die Koffer bleiben noch drin, da der Besichtigungsplan sonst durcheinander geraten wäre. Das Hotel ist sehr klein und liegt in einer engen Nebenstraße. Auf dem Weg zum „Platz der Revolution“ oder so ähnlich bemerkt Andreas plötzlich, dass wir gerade neben dem Palace Hotel vorbeifahren, wo ich doch noch meine Tablettensammlung liegen habe. Ich bitte Lina, den Bus kurz anzuhalten. Dann sprinte ich über die vollbefahrene 8-spurige Hauptstraße, um das Kästchen im Hotel abzuholen. Dort hat sich gerade eine größere Reisegruppe angemeldet. Ich muss also warten. Endlich komme ich dran und erkläre dem Mädel mein Anliegen. Sie greift zum Telefon, quasselt irgendwas mit einem anderen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin und sagt mir, die Tabletten wären gefunden worden und würden in zwei Minuten hergebracht. Erleichtert stelle ich mich an die Seite und warte. Und warte. Und warte. Es tut sich nichts. Ich bin die Concierge erneut um Hilfe. Sie telefoniert ein weiteres Mal und lächelt mich an, dass sie schon unterwegs wären.
In dem Moment kommt Lina reingeschneit. Der Bus konnte nicht länger warten und fährt seitdem in Kreisen um das Hotel. Was denn los wäre, fragt sie. Ich erklärte ihr, dass die Tabletten wohl jeden Moment kommen müssten. Lina sagte, das ist Quatsch, die müssten doch an der Rezeption liegen. Das hätte ihr jedenfalls das letzte Mal die Dame am Telefon gesagt. Das Mädel hinter den Tresen verneint, dass hier irgendwo was für mich liegen würde und schlug vor, dass wir direkt zu dem Mädchen gehen sollten, das die Tabletten gerade hat. Wir also in den Keller, ganz runter, bis in den Waschkeller. Hier hatte keiner auch nur den leisesten Schimmer, was wir überhaupt wollten. Geschweige denn, dass irgendjemand die Tabletten hätten. Also wieder hoch. Lina spielte ihre militärische Ausbildung voll aus und veranstaltete in der Lobby ein Tamtam, über das man noch Wochen sprechen wird. „Die Tabletten müssen hier in der Rezeption sein!“ sagte sie resolut (und natürlich auf usbekisch). Inzwischen waren schon drei Hansels hinter der Theke, die nun wild durcheinander alle möglichen Schubladen öffneten, ohne etwas zu finden. Sie wussten ja nicht einmal, wie das Kästchen aussieht! Dann empfahl die diensthabende Empfangsdame, dass wir doch bitteschön eine halbe Stunde warten sollten, dann käme die Finderin meiner Tabletten zu Dienst. An dem Punkt wollte ich aufgeben, aber Lina sagte, dass die Concierge lügen würde. Genau wie sie vorher gelogen hatte, dass die Tabletten im Haus unterwegs wären oder im Keller in der Wäscherei sein müssten. Alles Lügen. Sie forderte die Dame auf, nochmals gründlich alle Schubladen zu durchsuchen. Ich half mit einer genauen Beschreibung des Kästchens. Und plötzlich – ein Wunder! Die Kiste lag, in Plastik eingewickelt, die ganze Zeit direkt vor mir auf der anderen Seite des Tresens in der obersten Schublade, schön beschriftet mit: „Wird am 29.9. abgeholt. Zimmer 505“. Das muss man sich mal vorstellen: Die ganze Zeit hatte mir die Empfangsdame etwas vorgemacht und mich mit falschen Versprechungen hingehalten. Sie wusste von nichts und tat dennoch so, als wäre alles jeden Moment wieder in Ordnung. Lina sagte später, dies wäre leider ein sehr negativer Wesenszug der Usbeken. Sie erzählen einem die tollsten Sachen, halten aber nichts davon ein. Auf deutsch: Sie lügen wie gedruckt.
Als der Bus das nächste Mal um die Kurve kam, stiegen wir wieder ein. Bei der Gelegenheit ein großes Danke an die Mitreisenden, dass sie mich nicht gelyncht, sondern so geduldig auf mich gewartet haben. Die Besichtigung der großen Plätze war ohnehin viel langweiliger als unsere Geschichte.

Das letzte Mittagessen war wieder sehr gut. Meinen Gürtel muss ich ab sofort um ein Loch öffnen. Anschließend Freizeit. Ich habe mich eine halbe Stunde hingelegt und dann den Blog weitergeschrieben. Es muss ja zu einem Ende kommen.
Noch nicht ganz. Natürlich fehlt noch das letzte, gemeinsame Abendessen, an der tatsächlich wieder ALLE teilnehmen. Es ist ein ganz tolles Lokal mit dem besten Essen, das wir bisher bekommen haben. Kleiner Dämpfer: Direkt nach dem Abendessen sollen wir zu Bett gehen, da der Wecker bereits um 0:30 Uhr klingeln wird. NULL UHR DREISSIG! Tja, so ist es. Der Flieger nach Moskau – und weiter nach Frankfurt – geht schon um 4:00 Uhr morgens. Einige von uns beschließen, die paar Stunden bis zur Abreise durchzumachen.
Andreas bleibt auch gar nichts anderes übrig, da er sein Zimmer an Lina abgetreten hat. Lina hat nämlich mal wieder keinen Schlafplatz gefunden. Reiseleiter scheinen in der Hierarchie des Reisebusiness bestenfalls auf gleicher Ebene wie Straßenköter zu stehen. Pfui Trendtours! Wer immer dafür verantwortlich ist, sollte den Job mal selbst machen.
Und damit schließe ich diesen Reiseblog. Sollte sich noch etwas Weltbewegendes tun, werde ich es noch einbauen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wir morgen Nachmittag ab ca. 14.00 Uhr wieder in Frankfurt sind.
Außerdem will ich jetzt auch raus zu den anderen gehen, um die paar Stunden auch durchzumachen. Ich habe immer noch ein paar hunderttausend So´ms, die ich loswerden muss…
Taschkent, den 29.9.2018
Nachtrag: Mein Gewicht war nach zwei Tagen wieder auf dem „normalen“ Level, sofern man bei mir von „normal“ sprechen kann.





 Inzwischen war es schon fast ein Uhr Ortszeit geworden. Ich hatte eine superprofessionelle Showband gesehen und gehört, einen einigermaßen brauchbaren Wein getrunken und erste zarte Bande zur Bevölkerung geknüpft. Zeit, wieder ins Hotel zu gehen. Die Zahl der Mopeds hatte sich nur unwesentlich verringert, und der Versuch, eine Straße zu überqueren, kann durchaus ernste Folgen haben. Am besten ist es, einfach loszugehen, ohne mittendrin wieder stehen zu bleiben. Die Mopedfahrer rechnen nämlich damit, dass man weiterläuft – und passen ihren Fahrstil und die Fahrtrichtung entsprechend an. Wenn man aus Angst ständig stehenbleibt, irritiert das die Zweiradlenker und führt zu Staus und Unfällen. Auf grüne Fußgängerampeln muss man nicht achten, die sind nur zum Spaß da.
Inzwischen war es schon fast ein Uhr Ortszeit geworden. Ich hatte eine superprofessionelle Showband gesehen und gehört, einen einigermaßen brauchbaren Wein getrunken und erste zarte Bande zur Bevölkerung geknüpft. Zeit, wieder ins Hotel zu gehen. Die Zahl der Mopeds hatte sich nur unwesentlich verringert, und der Versuch, eine Straße zu überqueren, kann durchaus ernste Folgen haben. Am besten ist es, einfach loszugehen, ohne mittendrin wieder stehen zu bleiben. Die Mopedfahrer rechnen nämlich damit, dass man weiterläuft – und passen ihren Fahrstil und die Fahrtrichtung entsprechend an. Wenn man aus Angst ständig stehenbleibt, irritiert das die Zweiradlenker und führt zu Staus und Unfällen. Auf grüne Fußgängerampeln muss man nicht achten, die sind nur zum Spaß da.































 Zurück in Dalat, hatten wir den Rest des Tages zur freien Verfügung. Während die anderen die Zeit zu einer ausdauernden Stadtbesichtigung nutzen, lief ich ins Hotel zurück und testete die Küche des Hauses. Die Vorspeise – Frühlingsrollen mit Seadfood – schmeckte hervorragend. Auch das Gemüse, das den Reis des Hauptgangs bedeckte, war frisch und sehr lecker.
Zurück in Dalat, hatten wir den Rest des Tages zur freien Verfügung. Während die anderen die Zeit zu einer ausdauernden Stadtbesichtigung nutzen, lief ich ins Hotel zurück und testete die Küche des Hauses. Die Vorspeise – Frühlingsrollen mit Seadfood – schmeckte hervorragend. Auch das Gemüse, das den Reis des Hauptgangs bedeckte, war frisch und sehr lecker.
 26 Reiseteilnehmer und ein zunehmend gut gelaunter Luan waren die perfekten Zutaten für einen wunderbaren Abschiedsabend. Das Bier floss in Strömen, und irgendwann holte Luan auch noch die Reisschnapsflasche raus, die ihm seine Mutter bei seinem kurzen Besuch vor drei Tagen für uns „Langenasen“ mitgegeben hatte. Und als die Flasche alle war, bestellte er mit dem Geld, dass Annika noch von einer Sammlung für einen ganz anderen Zweck übrig hatte, mindestens zwei weitere Flaschen. Leider wurde wir dann auch ein bisschen laut. Das Bild des grölenden Deutschen im Ausland gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblingsmotiven, aber es ließ sich hier und heute nicht vermeiden.
26 Reiseteilnehmer und ein zunehmend gut gelaunter Luan waren die perfekten Zutaten für einen wunderbaren Abschiedsabend. Das Bier floss in Strömen, und irgendwann holte Luan auch noch die Reisschnapsflasche raus, die ihm seine Mutter bei seinem kurzen Besuch vor drei Tagen für uns „Langenasen“ mitgegeben hatte. Und als die Flasche alle war, bestellte er mit dem Geld, dass Annika noch von einer Sammlung für einen ganz anderen Zweck übrig hatte, mindestens zwei weitere Flaschen. Leider wurde wir dann auch ein bisschen laut. Das Bild des grölenden Deutschen im Ausland gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblingsmotiven, aber es ließ sich hier und heute nicht vermeiden.




















































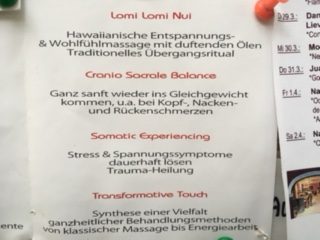








 Wie kann man da noch widerstehen?
Wie kann man da noch widerstehen?

















































